Patienten mit Migrationshintergrund
Multikulti-Praxisalltag

© Franz Pfluegl – Fotolia.com
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes leben in Deutschland etwa 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Etwa die Hälfte davon gehört zur Bevölkerung mit eigener Migrationserfahrung, die andere Hälfte ist bereits in Deutschland geboren und aufgewachsen. Am höchsten ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Großstädten: in Stuttgart mit 40%, in Frankfurt am Main mit 39,5% und in Nürnberg mit 37%. Mit Abstand wichtigstes Herkunftsland ist die Türkei mit fast 15% aller Zugewanderten.
Besonders Menschen mit eigener Migrationserfahrung, die einen Teil ihres Lebens in einem anderen Land und Kulturkreis verbrachten, haben oft Wertvorstellungen, die mit unseren nur bedingt übereinstimmen. Je stärker sich kulturelle Überzeugungen unterscheiden, desto wahrscheinlicher sind Interessenkonflikte. Das kann vom Praxisteam ein gewisses Fingerspitzengefühl erfordern. Besonders gilt das für Angehörige anderer Religionen, etwa muslimische Patienten, von denen es in Deutschland rund drei Millionen gibt.
Kommunikationsprobleme
Die Sprache ist in der Praxis oft die erste Barriere. Dass sich Arzt und Patient oder MFA und Patient sprachlos gegenüberstehen, kommt schon öfter mal vor. In vielen Fällen ist ohne Dolmetscher kaum eine Verständigung möglich. Da ein professioneller Dolmetscherdienst nicht existiert und auch zukünftig kaum finanzierbar sein dürfte, werden dann oft Familienmitglieder oder Bekannte zum Übersetzen herangezogen. Dadurch wird jedoch das klassische Vier-Augen-Gespräch zwischen Arzt und Patient unmöglich – für die Patienten wird es dadurch oft schwieriger, private Dinge und Probleme zu offenbaren. Außerdem: Wenn zwischen Patient und Familienmitglied ein Autoritätsverhältnis existiert, wie es gerade in islamischen Familien oft der Fall ist, kann es durchaus schon mal passieren, dass eine unliebsame Diagnose oder schlechte Prognose verschwiegen wird.
Religiöse Praxis
Viele Muslime befolgen ihre religiösen Grundpflichten. Darunter nimmt das Fasten einen besonders wichtigen Platz ein. Für gläubige Moslems heißt das: von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen und keinen Geschlechtsverkehr. Reisende, Stillende, Menstruierende, Schwangere und nicht zuletzt Kranke sind von der Fastenpflicht eigentlich ausgenommen, weil das Fasten ihren Körper zusätzlich belasten könnte. Doch viele gläubige Muslime bestehen auch als Erkrankte darauf, den Ramadan einzuhalten. Der Fastenmonat liegt immer im Sommer. In diesem Jahr dauert der Ramadan vom 11. August bis zum 8. September.
Problematisch kann das Fasten durch die Verschiebung des Essrhythmus und das teilweise übermäßige Essen und Trinken während der Nachtstunden vor allem bei Diabetikern sein. Sie sollten speziell begleitet werden, wenn sie fasten wollen. Vor allem ist darauf zu achten, dass Medikamente und Insuline, die Hypoglykämien verursachen können, in den Morgenstunden reduziert werden, um die Patienten nicht zu gefährden. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen ist es zudem ratsam, vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang viel zu trinken. Ein anderes, weniger bekanntes Gebot verlangt den Verzicht auf Arzneien, die nach den islamischen Sitten als verboten (harâm) geltende Mittel enthalten. Darunter fallen beispielsweise alle alkoholhaltigen, flüssigen Arzneien sowie aus dem Schwein gewonnene Präparate wie Herzklappen oder Gelatine bei Medikamentenkapseln.
Traditionen
Auch andere Traditionen als die Religion spielen eine wichtige Rolle bei der Gesundheitsversorgung. Oft ist Aufklärungsarbeit nötig, um Patienten bzw. Eltern von der Wichtigkeit dieser Untersuchungen zu überzeugen. Dazu zählen zum Beispiel die Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft und im Kindesalter. Die Untersuchungen U7 bis U9 werden nur von etwa 50% der Kinder aus Migrantenfamilien wahrgenommen (im Vergleich zu 90% bei deutschen Kindern), und die Impfraten nach Impfplan sind deutlich niedriger (58% gegenüber 84%). Diese Zahlen nennt die Bayrische Landesärztekammer. Und KiGGS – die große Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – belegt, dass Kinder aus Migrantenfamilien deutlich häufiger zu starkem Übergewicht bis hin zu Adipositas neigen (Abb.)
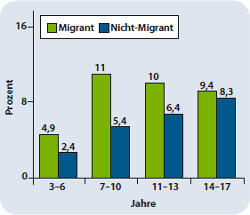 Kinder aus Migrantenfamilien sind häufiger stark übergewichtig.
Kinder aus Migrantenfamilien sind häufiger stark übergewichtig.
Migranten sind in den Disease Management Programmen oft unterrepräsentiert. Sind sie doch eingeschrieben, ist es wichtig, wenn Sie als Team regelmäßig darüber informieren, was die Patienten zu tun haben. Gerade bei älteren Patienten – die erste Generation der Migranten hat mittlerweile das Rentenalter erreicht – ist es oft so, dass sie mehrere Monate des Jahres in der alten Heimat verbringen möchten. Was natürlich dazu führen kann, dass wichtige Folgeuntersuchungen verpasst und die Patienten aus dem Programm ausgeschlossen werden. Hier ist klare Kommunikation wichtig.
Bei Schulungen im DMP ist oft eine Anpassung erforderlich – das betrifft nicht den Inhalt, sondern die Art, wie er vermittelt wird. Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft rät hier, Selbsthilfepotenziale zu nutzen. Es gibt durchaus Betroffene, die die Notwendigkeit von Schulungen erkannt haben, diese müssen als engagierte Multiplikatoren unterstützt werden. Oft muss sich der Kursleiter auf die sozialen Besonderheiten einstellen und die Patienten dort abholen, wo sie stehen. Das ist in deutscher Sprache schon schwierig genug, kommen noch Verständigungsprobleme hinzu, hilft nur viel Geduld und Einfühlungsvermögen.
Verständnis zeigen
Neben der kulturellen Identität ist häufig mangelndes Wissen der Grund dafür, dass Migrantenfamilien die Angebote unseres Gesundheitswesens nicht wahrnehmen. Sie sind oft nicht ausreichend informiert. Mit der Folge, dass es zur Fehl- oder Unterversorgung kommen kann. Wenn Sie in Ihrer Praxis viele Familien mit Migrationshintergrund haben, sollten Sie mit dem Arzt besprechen, wie Sie als Team am besten für verstärkte Prävention werben können. Verständnis für den Hintergrund der Patienten und geduldige Information sind auch hier die besten Ansätze, die kulturellen Gräben zu überbrücken.
Das Ziel, das Wissen von Migranten über Gesundheit und die Nutzung des Deutschen Gesundheitsdienstes zu verbessern, verfolgt auch das Projekt MiMi – Mit Migranten für Migranten – Interkulturelle Gesundheit in Deutschland vom Ethnomedizinischen Zentrum e.V. (EMZ) in Hannover. Auf der Website des Projektes (siehe Webtipps) finden Sie viele Ansätze und Materialien zur interkulturellen Gesundheitsförderung.
Webtipps
Informationen zum Thema Migranten und Gesundheitsversorgung finden Sie beim Ethnomedizinischen Zentrum und bei der Uni Mainz.

