Sprechstunde
Aus der Medizin
Tipps für den Praxisalltag
Intramuskuläre Impfungen
Das Durchführen von Schutzimpfungen gehört zu den Routineaufgaben einer Hausarztpraxis. So funktioniert sie zuverlässig und möglichst schmerzarm für den Patienten.
mehr...Populäre Irrtümer in der Medizin
Zeit der Wintermärchen
Märchen werden von Generation zu Generation weitergegeben – weil sie fantasievoll und schön anzuhören sind. Mit manchem Gesundheitstipp für den Winter ist es ähnlich: Im besten Fall sind sie wirkungslos, mitunter aber sogar gefährlich. Wir haben ein paar populäre Irrtümer zusammengetragen, die sich vor allem um wintertypische Beschwerden drehen.
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
Mit der letzten Pflegereform 2008 wurde das Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz) eingeführt. Damit haben sich die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege verbessert. Arbeitnehmer können für die Pflege eines nahen Angehörigen freigestellt werden. Man unterscheidet zwischen der kurzfristigen Freistellung von bis zu zehn Arbeitstagen sowie der Pflegezeit von bis zu sechs Monaten.
Zum 1. Januar 2012 soll das Gesetz zur Familienpflegezeit in Kraft treten. Es sieht vor, dass pflegende Angehörige ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre um maximal 50 Prozent reduzieren können und dafür 75 Prozent ihres Gehalts beziehen. Im Gegenzug sollen die Beschäftigten im Anschluss an die Pflegezeit wieder Vollzeit arbeiten und dafür zunächst 75 Prozent ihres Gehalts erhalten – so lange, bis der Saldo wieder ausgeglichen ist. Einen Rechtsanspruch für den Beschäftigten auf die Pflegezeit gibt es allerdings nicht.
Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege stand auch im Fokus eines Projekts des Zentrum Frau in Beruf und Technik, das u. a. von der EU und dem Land NRW gefördert wurde. Die BARMER GEK hat sowohl als Krankenkasse sowie auch in ihrer Funktion als Arbeitgeberin das Projekt maßgeblich mitgetragen. Die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse bündelt der BARMER GEK Gesundheitsreport 2011, der das Thema Beruf und Pflege zum Schwerpunkt hat. Darüber hinaus wurde ein Ratgeber für Berufstätige, die Angehörige pflegen, entwickelt.
Tipps für den Praxisalltag
Hilfe bei der Blutentnahme
Bei der Blutentnahme gilt die alte Weisheit, dass vor allem Übung den Meister macht. Wir haben noch einmal die wichtigsten Tipps zusammengestellt, wie man bei dieser wichtigen Aufgabe unnötiges Blutvergießen vermeidet.
Kurz notiert
Versorgung auf dem Land
Wie kann die medizinische Versorgung in bevölkerungs- und
strukturschwachen Regionen sichergestellt werden? Der AOK-Bundesverband
möchte diese Diskussion auf der Basis wissenschaftlicher Grundlagen
begleiten und hat die Ergebnisse eines Expertengesprächs zum Thema
veröffentlicht.
www.aok-gesundheitspartner.de
Nadelstichverletzungen
Beschäftigte in Arztpraxen werden offensichtlich noch immer nicht
ausreichend vor blutübertragbaren Infektionen geschützt. In einer
Online-Befragung, an der über 200 medizinische Fachangestellte
teilnahmen, gaben 66 Prozent der Befragten an, mindestens eine
Nadelstichverletzung in ihrem Berufsleben gehabt zu haben.
www.vmf-online.de
Bobath-Pilotprojekt
Das Bobath-Konzept ist ein Pflege- und Therapiekonzept zur Rehabilitation von Menschen mit
Bewegungsstörungen und Lähmungserscheinungen. In einem Pilotprojekt der Barmer GEK und des Bundesverbandes selbstständiger Physiotherapeuten (IFK) sollen MFA eine wichtige Rolle bei der Hilfe für pflegende Angehörige spielen.
www.barmer-gek.de
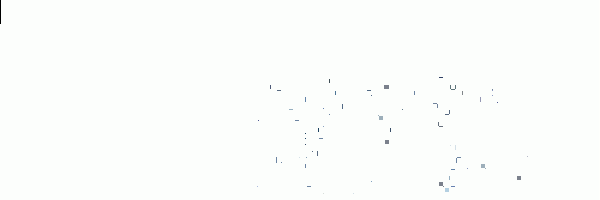
Kurzmeldungen
Per E-Mail der Grippe auf der Spur
Mit dem GrippeWeb gibt es seit dem vergangenen März ein neues Grippeüberwachungsinstrument des Robert Koch-Instituts (RKI), das sich explizit an die Bevölkerung richtet. Nach einem halben Jahr liegen jetzt erste Daten vor. Demnach sind bisher etwa 1.400 Teilnehmer beim GrippeWeb registriert. Die Teilnehmer erhalten wöchentlich eine E-Mail, in der sie gefragt werden, ob in der vergangenen Woche ein Atemwegsinfekt aufgetreten sei.
Wenn ja, dann gibt es einige weitere Fragen, mit denen grippeähnliche Krankheitsverläufe identifiziert werden sollen. Außerdem wird gefragt, ob ein Arzt aufgesucht wurde oder nicht. Die bisher erhobenen Daten zeigen, dass die Hälfte aller registrierten Kinder in den Sommermonaten mindestens zwei akute respiratorische Infekte hatten. Über alle Teilnehmer gerechnet sind Erkältungen etwa dreimal häufiger als grippeähnliche Erkrankungen.
Ob ein Arzt aufgesucht wird oder nicht, wird offenbar davon abhängig gemacht, wie schwer die Erkrankung ist. Bei Erkältungen geht nur jeder fünfte Betroffene zum Arzt. Bei grippeähnlichen Erkrankungen ist es immerhin jeder dritte. Mit Blick auf die bevorstehende Grippesaison bittet das RKI Ärzte und Praxisteams, auf das GrippeWeb aufmerksam zu machen, um die Datengrundlage zu verbreitern und das GrippeWeb zu einem wichtigen Baustein der Grippeüberwachung zu entwickeln.
Aus der Ärzte Zeitung
Die eGK ist da
Nun ist sie da, die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Seit dem 1. Oktober 2011 ist die Ausgabe bei den Krankenkassen angelaufen, seit diesem Tag ist sie auch offizieller Versicherungsnachweis. So steht es im § 3 Abs. 1 zur bundesweiten Festlegung der Pauschalen zur Lesegeräte-Ausstattung. In der Praxis heißt das: Jeder Patient muss bei Vorlage der eGK behandelt werden und es darf keine Privatrechnung ausgestellt werden. Das ist nur zulässig, wenn der Patient gar keine Karte vorlegt. Aktuell haben im Bundesdurchschnitt 80 Prozent der Vertragsärzte die neuen Kartenlesegeräte installiert. Wenn alle bestellten neuen Kartenleser in den Praxen installiert sind, werden etwa 92 Prozent der Vertragsärzte mit den neuen Geräten ausgestattet sein. Das geht aus aktuellen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigungen hervor.
Patienten, die in den kommenden Monaten mit der neuen Karte ausgestattet werden, sollten also in der Regel keine Probleme beim Einlesen der Karte haben. Ist das Lesegerät einer Praxis nicht in der Lage die eGK zu lesen, muss das Ersatzverfahren angewandt werden, d.h. im Praxissystem werden die Versichertendaten (Name und Anschrift des Patienten, Krankenversichertennummer, Kartennummer usw.) manuell eingetragen. Bei Fragen zur elektronischen Gesundheitskarte können sich die Praxisteams auch an die Geschäftsstellen der jeweiligen Krankenkasse wenden.
Impfbroschüre für Patienten
Sie wollen alle Patienten möglichst optimal versorgen, aber nicht
immer reicht die Zeit? Gerade zum Impfen haben viele Patienten oft die
gleichen Fragen. Darum hat Springer Medizin in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eine Broschüre ( HTML | PDF ) erstellt, in der die 20 häufigsten Patientenfragen
leicht verständlich beantwortet sind.
Serie Arzneimittelverordnung: Darreichung
Richtig einnehmen
Die beste Medikation ist wirkungslos, wenn die Patienten nicht wissen, wie sie richtig mit Tabletten, Dragees und Kapseln umgehen sollen. Wann müssen die Medikamente genommen und wie gelagert werden? Welche Zubereitungen darf man teilen und welche nicht? Bei solchen Problemen ist das Praxisteam gefragt.
Rückenschmerz
In der Klemme
Rückenschmerz ist eine Volkskrankheit, doch oft finden sich keine organischen Ursachen. Vor allem Fehlhaltungen, Stress und Drucksituationen hinterlassen schmerzhafte Spuren. Spritzen oder Operationen helfen dann nur selten aus der Klemme.
Vor dem Arzttermin ins Internet?
Patienten vertrauen nach wie vor ihrem Arzt – doch vor und nach der Sprechstunde holen sie sich weitere Informationen aus dem Netz. Damit festigt das Internet seine Rolle als wichtigster Kanal für die Gesundheitskommunikation: 41 Prozent der deutschen Online-Bevölkerung befragen das Internet vor einem Arztbesuch, immerhin 31 Prozent nach einem Termin. Dabei informieren sich gesetzlich Versicherte (57 Prozent) eher als privat Versicherte (46 Prozent) aktiv im Netz über Gesundheitsthemen. Dies geht aus der repräsentativen Gesundheitsstudie von MSL Germany und SKOPOS hervor.
Foren, in denen die Betroffenen anonym auftreten, spielen eine deutlich wichtigere Rolle als soziale Netzwerke wie Facebook. Während sich fast jeder Zweite vorstellen kann, in Foren zu posten, ist nur eine Minderheit geneigt, etwa einer Gruppe zu einer medizinischen Indikation auf Facebook beizutreten.
Vor allem für chronisch kranke Menschen, für die Krankheit in vielen Fällen ein täglicher Begleiter ist, eröffnen sich vielfältige neue Kommunikationsmöglichkeiten. Dies gilt im direkten Kontakt zu Ärzten oder Krankenhäusern oder auch zu anderen Patienten. Nicht umsonst werden Internetforen zu Gesundheitsthemen oder auch die Möglichkeit mit der eigenen Arztpraxis per E-Mail in Kontakt zu treten von den meisten chronisch Kranken begrüßt.
Serie Arzneimittelverordnung: Polypharmazie
Tatort Pillenbox
Patienten mit mehreren Erkrankungen erhalten oft einen ganzen Mix von Medikamenten – und therapieren sich darüber hinaus auch noch selbst. Was kann man da noch gegen unerwünschte Wirkungen tun? Eine Spurensuche am Tatort Pillenbox.

